|
|
Kurzbiographien
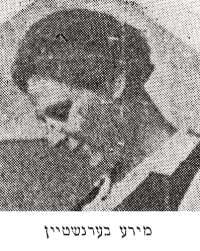
Quelle: Marc Dworzecki: Jerushaleiym
deLite. in kamf un umkum, S. 266
|
Mire
Bernshteyn
Mire Bernshteyn arbeitete schon vor dem Einmarsch der
Deutschen als Lehrerin. Während der sowjetischen Besatzungszeit vor dem
Einmarsch der Deutschen war sie Leiterin des Realgymnasiums in Wilna. Sie
engagierte sich in kommunistischen Zirkeln mit dem Ziel, im Rahmen dieser
Bewegung eine Erneuerung der jiddischen Kultur und speziell des jüdischen
Erziehungswesens zu erreichen. Gemeinsam mit einigen ihrer SchülerInnen zog sie,
deren Eltern schon umgebracht worden waren, in das Ghetto und sammelte dort
gleich in den ersten Tagen ehemalige SchülerInnen um sich und war Mitbegründerin
der Schule im Ghetto. Sie las Werke der jüdischen Literatur wie Perez und Sholem
Aleiychem und unterrichtete Hebräisch und Jiddisch. Sie war aktives Mitglied der
F.P.O.. Mire Bernsteyn wurde ermordet.
|

Quelle: Grigorij Schur: Die Juden von Wilna, S. 97 |
Jacob
Gens
Jacob Gens, geb. 1905, hatte 1919 als Freiwilliger in der
litauischen Armee gedient. Als Zionist stand er den Revisionisten nah. Anfang
September 1941, als der erste Judenrat gegründet wurde, ernannte man ihn zum
Chef der jüdischen Polizei. Im Juli 1942 wurde er zum einzigen Repräsentanten
des Judenrats im Ghetto bestimmt. Er regierte diktatorisch über die Belange des
Ghettos und war überzeugt von der Idee „Leben durch Arbeit", um so zumindest
einem Teil der Menschen, wenn die Deutschen an der Front geschlagen seien, das
Überleben zu sichern. Das Konzept war umstritten – hatte es z.B. zur Folge, dass
Gens die ihm unterstehende Polizei zu Selektionen in die Umgebung Wilnas befahl
und aktiv die Vernichtung unterstützte.
Seine Haltung zum bewaffneten Widerstand war ambivalent. Er
unterhielt Kontakt mit einzelnen Brigadeleitern und schien einen Aufstand gegen
die Liquidierung zu befürworten. In den letzten Wochen des Ghettos bekämpfte er
die Aktivitäten des Untergrunds, forderte aktiv die Auslieferung Yitzhak
Witenbergs.
Er weigerte sich aber auch, das Ghetto vor der Liquidierung zu verlassen und
wurde von den Deutschen noch vor der Liquidierung erschossen.
|

der bekannte Gesangslehrer Jakob Gershteyn,
im Ghetto gezeichnet von Rochel Sutzkever
Quelle: Shmerke Kaczerginski: Churbn Wilne, S. 81
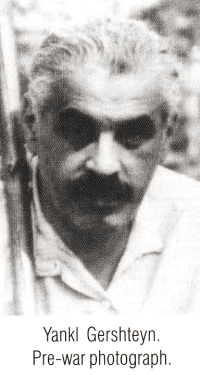
ein Bild aus der Vorkriegszeit
Quelle: Rachel Kostanian: Spiritual Resistance in the Vilna Ghetto, S.39 |
Yankl
Gershteyn
Yitzhak
Rudashevski liegt mit einer Gelbsucht zu
Hause als er erfährt, dass der beliebte und bewunderte Lehrer und Musiker Yankl
Gershteyn gestorben ist. Gershteyn war eine wichtige Persönlichkeit im Wilnaer
Kulturleben und vor allem jüdischen Erziehungswesen, Gründer verschiedener Chöre
und Schriftsteller. Yitzhak erinnert sich: "… Der Lehrer Gershteyn litt sehr im
Ghetto. Er wurde grauer und grauer, sein Gesicht verdunkelte sich. Er wohnte in
einer Klasse unserer Schule und konnte kaum die Stufen bewältigen, die er sonst
fröhlich hinaufgestiegen war. … Ein alter Mann, vor seiner Zeit, ging er langsam
durch die Gassen des Ghettos, doch der Kopf war aufrecht wie gewohnt. … Das
Ghetto zerbrach ihn und er überlebte nicht. … Ich werde dich immer erinnern als
einen guten Freund, das Bild deiner stolzen Erscheinung wird uns kostbar und
lieb bleiben." (Yitzhak Rudashevski, S. 61)
|
|

der Partisan Shmerke Kaczerginski
Quelle: Shmerke Kaczerginski: Churbn Wilne, S. III
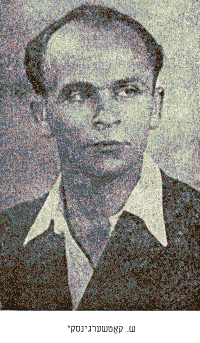 |
Shmerke
Kaczerginski
Shmerke Kaczerginski war Schriftsteller und Dichter und vor
dem Einmarsch der Deutschen Mitglied einer Künstlergruppe.
Auch im Ghetto schrieb er und viele seiner Lieder wurden im
Ghetto populär (Ponarlied). Er war
aktiv im Jugendclub und Mitglied der F.P.O.. Kurz vor der Liquidierung verließ
er mit einer Gruppe das Ghetto und gelangte zu den Partisanen im Wald. Als
Mitglied einer jüdischen Partisaneneinheit (mit seinen Freunden Abba
Kovner, Avrom
Sutzkever
und anderen) war er bei der Befreiung der Stadt Wilna durch die Rote Armee
beteiligt. Die jüdische Gruppe begann gleich damit, die versteckten Dokumente
und Kulturgüter aus den Malinen des Ghettos zu holen und ein jüdisches Museum
aufzubauen. Auf Befehl Stalins wurde dieses Museum 1949 im Rahmen seiner
Kampagne gegen Zionismus und Kosmopolitismus geschlossen. Shmerke wanderte nach
Argentinien aus. Aus seiner Feder sind wichtige Dokumente und Erinnerungen zu
dem Ghetto in Wilna und den Kämpfen der Partisanen entstanden.
|
|

Quelle: Rachel Kostanian: Spiritual Resistance in the Vilna Ghetto, S. 24

Shmerke Kaczerginski und Abba Kovner
Quelle: Shmerke Kaczerginski: Churbn Wilne, S. 32 |
Abba
Kovner
(Deckname Uri)
Abba Kovner war 25 Jahre alt und aktives Mitglied der Gruppe
HaShomer HaZair in Wilna. Als Deutsche und Litauer mit den mörderischen
Menschenjagden begannen, versteckte sich Abba mit einigen seiner Mitstreiter in
einem wenige Kilometer von Wilna entfernt gelegenen Kloster dominikanischer
Nonnen. Dort erreichte sie die Nachricht von den massenhaften Verschleppungen
nach Ponar.
Abba Kovner zählt zu den Mitverfassern des legendären Aufrufs der
Untergrundbewegung ( Link
Aufruf) und wurde auf der
Gründungsversammlung der F.P.O. im Dezember 1941 zu einer der Führungspersonen
gewählt. Mit einer der letzten Gruppen verließ er das Ghetto im September 1943
und gelangte zu den Partisanen im Wald. Dort leitete er die jüdische
Partisanengruppe „Nakam" (hebr. Rache):
"… Ich erinnere das erste Mal als wir einen Zug aufmischten. Ich ging mit einer
kleinen Gruppe, Rachel Markewitch begleitete uns. Es war der Neujahrsabend: wir
brachten den Deutschen ein festliches Geschenk. Der Zug erschien auf den
Bahnschienen, eine Reihe großer, schwer beladener Waggons Richtung Wilna. Mein
Herz stoppte plötzlich vor Freude und Angst. Ich zog den Zünder mit aller Kraft,
und in dem Moment, bevor der Donner der Explosion in der Luft ein Echo gab und
21 Waggons voller Truppen in den Abgrund stürzten, hörte ich Rachel rufen: `Für
Ponar!´ … „ (aus: "A first Attempt to Tell"
in: Yehuda Bauer (Hg.): "The Holocaust as Historical Experience: Essays and
Discussion, New York 1981, S. 81/82).
Abba Kovner überlebte den Krieg. Er lebte als Schriftsteller in Israel, er starb
1987.
|
|
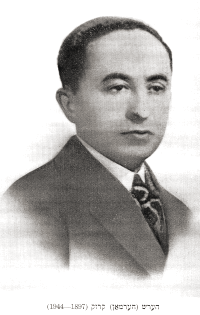
Quelle: Herman Kruk: togbukh fun Wilner geto, S. III
|
Herman
Kruk
Herman Kruk, geb. 1896, war aktiver Bundist und engagiert in der
„Kultur-Liga" und dem Jugendverband des Bundes "Zukunft". Die politische
Bildungsarbeit war für ihn das Werkzeug, die jüdische Arbeiterjugend in
politischen und sozialen Auseinandersetzungen gegen Antisemitismus und
Diskriminierung zu stärken: Lesen – Erkenntnis – Emanzipation und politische
Aktion. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Grosser-Bibliothek in Warschau
zur größten und populärsten jüdischen Volksbibliothek. Er leitete auch das
Bibliothekszentrum der "Kultur-Liga", eine Fortbildungseinrichtung der etwa 400
jüdischen Bibliotheken in Polen und veröffentlichte in diversen Zeitschriften
Artikel zu Themen der jüdischen Kultur und des Bibliothekswesens.
Herman Kruk floh vor den Deutschen aus Warschau nach Wilna. Er bekam Arbeit als
Pressereferent und veröffentlichte u.a. einige Reportagen über die Situation von
Flüchtlingen in Wilna und das Leben der Kinder in dieser Situation.
Herman Kruks Name ist auch unauslöschlich verbunden mit seinem Engagement im
Ghetto von Wilna als Bibliothekar der Ghettobibliothek und als Chronist des
Geschehens im Ghetto. Vom Beginn der deutschen Besatzung soll er sich der
Chronik gewidmet haben. Im Ghetto schreibt er fast täglich, nicht alle
Aufzeichnungen sind erhalten. Unter dem Datum des 4. September 1941 schreibt er:
" … es ist mein letzter Wunsch: die Wörter sollen in die Welt der Lebenden
gelangen … Wird dann die Welt nicht schreien? Wird die Welt einmal Rache
nehmen?" (Kruk, S. 54)
Herman Kruk wurde von den Deutschen bei der
Liquidierung des Ghettos nach Estland deportiert und im Lager Klooge ermordet.
|

Quelle: Rachel Kostanian: Spiritual Resistance in the Vilna Ghetto, S. 24 |
Sonje
Madeisker
Sonje Madeisker war vor der deutschen Besatzung Mitglied einer
kommunistischen Jugendgruppe. Im Getto war sie Mitglied der F.P.O., lebte als
"Arierin" getarnt außerhalb des Ghettos und konnte so Kontakte knüpfen,
Schutzwohnungen besorgen, etc. Maria Rudashevski erinnert sich: "Von Gita habe
ich viel Interessantes über die Komsomolzin Sonja Madeisker erfahren. Mit
falschen Papieren, als Polin, sollte sie die Frontlinie überschreiten und sich
nach Welikije Luki durchschlagen. Sie wurde jedoch ergriffen. Beim Verhör sagte
sie kein Wort. Sie wurde zum Tode verurteilt. Am letzten Abend gelang es ihr,
den faschistischen Bestien zu entkommen.
Sonja Madeisker ist nach Vilnius zurückgekehrt. Sie lebt illegal in der Stadt
und lässt sich von keinerlei Gefahren davon abhalten, weiter zu arbeiten, sie
hilft Waffen zu besorgen, kommt ins Ghetto und hält die Verbindung mit den
illegal arbeitenden Kommunisten in der Stadt aufrecht."
(Mascha Rolnikaite 1966, S. 90)
|
|
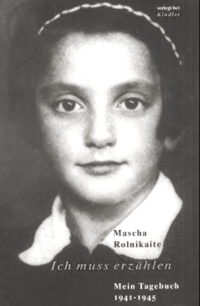
Mascha Rolnikaite
Quelle: Mascha Rolnikaite: Ich muss erzählen,
Buchumschlag
|
Mascha
Rolnikaite
Mascha Rolnikaite wurde in den ersten Tagen der deutschen
Besatzung gerade 14 Jahre alt. Sie schrieb im Ghetto ein Tagebuch, dass sie auf
Anraten der Mutter aus Sicherheitsgründen auswendig lernte. Sie wurde vor der
endgültigen Liquidierung des Ghettos in die Konzentrationslager transportiert
und in Stutthof von der Roten Armee befreit. Sie überlebte die Shoah und lebt
heute in Sankt Petersburg. 2002 wurden ihr Aufzeichnungen zum ersten Mal
unzensiert in deutscher Sprache veröffentlicht (vgl. Literatur).
|
|

Quelle: Yitzhak Rudashevski: Diary from the Vilna Ghetto,
S. 34
|
Yitzhak
Rudashevski
Yitzhak Rudashewski war vierzehn Jahre alt, als die Deutschen in
Wina einmarschierten und besuchte das Realgymnasium. Im Ghetto schrieb er
heimlich sein Tagebuch: er erlebt und beschreibt die wachsende Verzweiflung des
Alltags, der geprägt ist von Verfolgung und Tod, aber auch die Bemühungen des
kulturellen und spirituellen Widerstands. Yitzhak engagierte sich im Jugendclub
des Ghettos: Die Jugendlichen beschäftigten sich in Literaturzirkeln mit
jüdischer Geschichte, organisierten eine Ausstellung mit den aus dem Beutelager
geretteten Kulturgütern und setzten sich gemeinsam mit dem Alltag des Ghettos
auseinander. Als die Deutschen das Ghetto liquidierten, waren er und seine
Familie in einer Maline versteckt. Sie wurden entdeckt und in Ponar umgebracht.
Als einzige konnte sich seine Cousine Sore Voloshin aus dem Massengrab retten.
Sie gelangte zu den Partisanen und fand nach der Befreiung das Tagebuch im
Ghetto. So ist es uns erhalten.
|

Ona Schimaite, Foto aus der Vorkriegszeit,
Vilna Gaon Jewish State Museum
Quelle: Rachel Kostanian: Spiritual Resistance in the Vilna Ghetto , S. 77 |
Ona
Schimaite
Die Nichtjüdin Ona Schimaite arbeitete in der
Universitätsbibliothek in Wilna. Sie rettete nicht nur über 200 Briefe, die sie
aus dem Ghetto erreichten, und wichtige Kulturgüter, die sie entweder aus dem
Ghetto schmuggelte oder von den Beutelagerarbeitern bekam. Sie riskierte auch
ihr Leben, um einzelne Juden zu retten. Sie überlebte die Nazizeit.
|

Quelle: Rachel Kostanian: Spiritual Resistance in the Vilna Ghetto |
Yekhiel
Sheynboym
Er leitete die HeChalutz-Gruppe im Ghetto, war Mitglied der
F.P.O. und favorisierte den Kampf gegen die Deutschen in den Wäldern.
Nichtsdestotrotz war er der Leiter der Verteidigungsgruppe, die bei der
Liquidierung des Ghettos an der ersten Barrikade die Deutschen aufhielt.
Sheynboym und seine Gruppe wurden an dieser Barrikade getötet.
|

Avrom Sutzkever, in den Tagen der Befreiung
Quelle: Avrom Sutzkever: fun Wilner geto, S. 187

Avrom Sutzkever
und Shmerke Kaczerginski vor ihrer Wohnung im Wilnaer Ghetto
Quelle: Avrom Sutzkever: fun Wilner geto, S. 187 |
Avrom
Sutzkever
Vor dem Einmarsch der Deutschen war er Dichter und, wie Shmerke
Kaczerginski, Mitglied einer Künstlergruppe. Er wurde schon 1941 von den
Deutschen verhaftet, konnte jedoch fliehen. Im Ghetto engagierte er sich im
Jugendclub und anderen kulturellen Initiativen. So war er in der
Gründungsmitglied des Theaters im Ghetto. Sutzkever verließ mit den letzten der
Widerstandbewegung das Ghetto und kämpfte bei den Partisanen bis zur Befreiung
der Stadt Wilna. 1946 sagte er bei den Nürnberger Prozessen aus. Er lebt in
Israel und hat u.a. über das Ghetto und die Kämpfe der Partisanen geschrieben.
|

der "Vater" der Wilnaer
Juden
Quelle: Shmerke Kaczerginski: Churbn Wilne, S. 161 |
Yakov
Wigodski
Dr. Jakob Wygodski (1857-1941)
war Arzt und langjähriges Oberhaupt der Wilnaer Jüdischen Gemeinde. In der
ersten Regierung nach der Unabhängigkeit Litauens war er Minister für
jüdische Angelegenheiten, dann Deputierter im polnischen Sejm. Er wurde der
„Vater der Wilnaer Juden" genannt (vgl. Grossmann/Ehrenburg, S. 473).
Er war Mitglied einer Anti-Hitler-Kommission, bevor die Deutschen in Wilna
einmarschierten. Unermüdlich versuchte er sich gegen die schikanierenden
Maßnahmen zur Wehr zu setzten.
Er starb nicht lange nach einer Begegnung mit Murer, bei der dieser ihn die
Brutalität der Deutschen hatte spüren lassen.
|

Yitzhak Witenberg, Kommandant der F.P.O.,
gezeichnet von N. Borowski
Quelle: Avrom Sutzkever: fun Wilner geto, S. 155 |
Jitzhak
Witenberg (Deckname Leon)
Jitzhak Witenberg (1907-1943) war der Kommandeur der F.P.O. im
Wilnaer Ghetto. Als Jugendlicher hatte er sich in der gewerkschaftlichen
Bewegung engagiert und war der Kommunistischen Partei beigetreten. 1936 wurde er
Mitglied des Gewerkschaftsrates in Wilna. Während der Sowjetischen Besatzung war
er Vorsitzender der Gewerkschaft der Lederarbeiter. Als die Deutschen einfielen,
stand er auf ihren Listen der Aktivisten der KP und musste sich verstecken. Von
Beginn der Okkupation stand für ihn der bewaffnete Widerstand außer Frage. In
der Debatte um die Möglichkeiten der F.P.O. vertrat er den Standpunkt, das
Ghetto bei der Liquidierung mit allen Mitteln zu verteidigen und dann, wenn noch
möglich, zu den Partisanen zu stoßen. Er wurde am 16. Juli 1943 von der Gestapo
in Wilna ermordet.
|

hagalil.com 11-02-2003 |
|
|