|
[Spurensuche
jüdischer Geschichte
– das Ghetto in Wilna]
Widerstand im Ghetto
Wie waren die Bedingungen des jüdischen Widerstands?
Wenn wir über Widerstand sprechen, verbinden wir damit ganz
bestimmte Ideen: eine Widerstandsbewegung kämpft für bessere Lebensbedingungen,
für die Befreiung einer Gruppe, eines Volkes oder eines Landes. Die
Widerstandsgruppen haben Verbündete außerhalb ihres Kampfgebietes, sie werden
ideell und/oder materiell unterstützt. Sie agieren taktisch, um möglichst viele
ihrer Ziele zu erreichen.
Diese Faktoren lassen sich nicht auf die Situation der
Widerstandsgruppen in den Ghettos übertragen:
-
Wie soll um Freiheit gekämpft
werden, wo das Lebensrecht grundsätzlich in Frage gestellt ist? Die
Widerstandsgruppen kämpften nicht um bessere Lebensbedingungen oder gar
Befreiung. Der Kampf war angesichts des die Vernichtung aller Juden
planenden Gegners ein Kampf um einen würdigen Tod.
-
Sie kämpften ohne Verbündete. Es
gibt genügend Beispiele, in denen Juden nicht in Partisanengruppen
aufgenommen wurden, Antisemitismus war nicht selten der Grund. Die
einzig wirklich Verbündeten waren die in anderen Ghettos ebenfalls
eingesperrten KampfgefährtInnen.
-
Sie erhielten materiell, etwa
bei der Beschaffung von Waffen, nur marginal Unterstützung von anderen
kämpfenden Gruppen. Es gab hauptsächlich mutige Einzelpersonen, die im
logistischen Bereich halfen wie auch in allen anderen (etwa Menschen
verstecken, Waffen und Nahrung beschaffen, Dokumente aus dem Ghetto
schaffen, etc).
Wie definieren wir den jüdischen Widerstand?
Angesichts des auf die Vernichtung aller Juden abzielenden
Vorgehens der Deutschen war der Spielraum für jegliche Form von Widerstand
begrenzt. In der Enge der Ghettos wehrten sich Juden, wenn und wo es möglich
war. In der heterogenen Zwangsgemeinschaft des Ghettos entstanden
unterschiedlichste Formen von Widerstand.
Kultureller Widerstand
Der kulturelle Widerstand spiegelt sich in all jenen Aktivitäten
wider, die Überlebenskraft und -willen und die Identität stärkten: dieser
Widerstand drückte sich aus in den medizinischen Versorgungssystemen, in den
Schulen und Jugendclubs, in den Bildungs- und Kultureinrichtungen im Ghetto, in
Veranstaltungen und künstlerischen Aktivitäten. Es entstanden in der heterogenen
Gemeinschaft des Ghettos weitere unterschiedlichste Interessensgemeinschaften,
in denen versucht wurde, die inhumane Situation gemeinsam durchzustehen und in
der Konfrontation mit dem durch und durch unmoralischen Gegner eine eigene Moral
und Stärke aufrecht zu erhalten. All diese Initiativen stellten sich gegen die
von den Deutschen verordnete Doktrin.
Die
Anfälligkeit für Krankheiten war in den Verhältnissen des Ghettos extrem hoch.
Frauen und Männer, die im medizinischen Bereich arbeiteten, führten regelmäßig
Aufklärungskampagnen durch, wie z.B. mit aus der schlechten Ernährung
resultierenden Mangelerscheinungen umzugehen sei, welchen speziellen Gefahren
Kinder ausgesetzt waren, wie Epidemien vorgebeugt und bekämpft werden konnten.
Es gab ein Spital und ambulante Behandlungszentren, zwei Bäder mit
Desinfektionsräumen. ZwangsarbeiterInnen, die bei dem Deutschen Roten Kreuz
arbeiteten, schmuggelten Medizin ins Ghetto. 1942 verboten die Deutschen in
allen litauischen Ghettos Geburten. Nichtsdestotrotz wurden im Spital im Wilnaer
Ghetto Kinder geboren. Die Säuglinge wurden in einer speziellen Maline
versteckt.
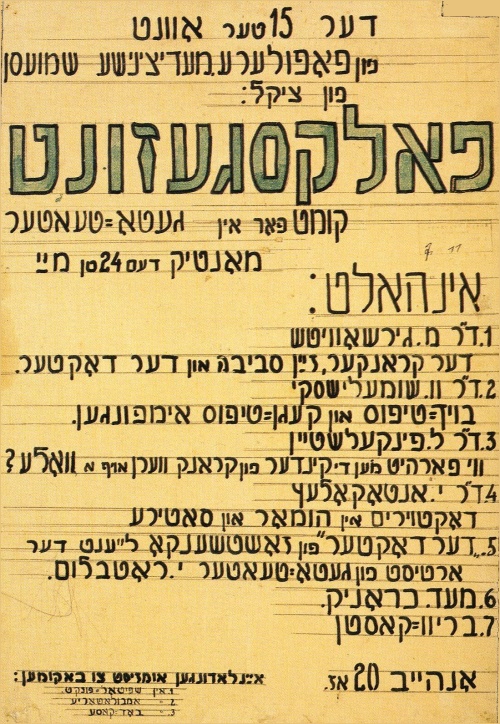
medizinische Aufklärung
Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters, 13.VZM 1223
Übersetzung:
Der 15. Abend
populär-medizinischer Unterhaltung
Volksgesundheit
findet statt im Ghettotheater, Montag, 24. Mai
Inhalt:
1. Dr. M. Girshovitsh
Der kranke Mensch, seine Umgebung und der Arzt
2. Dr. V. Shumelishky
Typhusfieber und Impfungen gegen Typhus
3. Dr. L. Finkelshtein
Wie können Kinder vor Schilddrüsenmangelerscheinungen geschützt werden?
4. Dr. I. Antokolets
Ärzte in Humor und Satire
5. "Der Doktor" von Zoschenko
gelesen von dem Schauspieler des Ghettotheaters I. Rotblum
6. Medizinische Chronik
7. Briefkasten
Beginn 20.00 Uhr
Einladungen umsonst
1. im Hospital
2. in der Krankenstube
3. im Bad
Schulen und Jugendclub im Ghetto
Gleich am ersten Tag des Ghettos entstand die erste Schule: Mire
Bernstein, die ehemalige Direktorin des Real-Gymnasiums in Wilna, war mit
einigen Kindern ihrer Schule, deren Eltern umgebracht worden waren, ins Ghetto
gekommen. Andere LehrerInnen kamen hinzu und richteten Räume für die
Schulstunden her. Der Unterricht begann sofort, in den ersten Wochen
unregelmäßig wegen der permanenten Razzien und Selektionen. Später gab es drei
Grundschulen, zwei Kindergärten, eine technische Schule, eine Musik- und eine
höhere Schule und ein Waisenhaus.
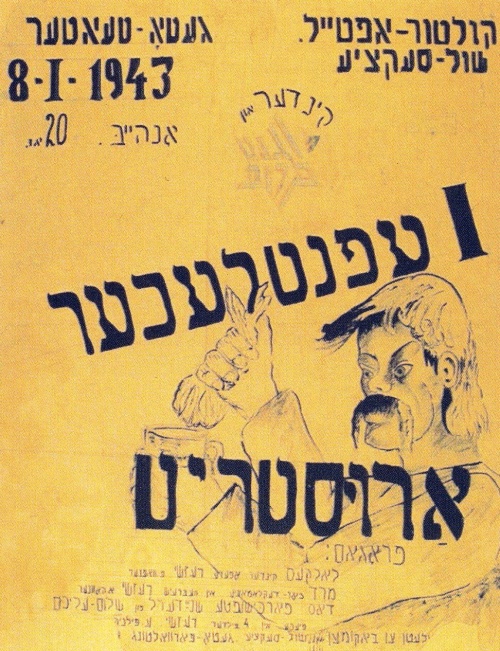
Jugendclub
Quelle: Katalog zur Ausstellung "shtarker fun aysn", FfM 2002, S. 306
Übersetzung:
Kultur-Abteilung
Schulreferat
Ghettotheater
8.1.1943
Beginn: 20.00 Uhr
Kinder- und Jugendclub
1. öffentlicher Auftritt
Programm:
Lalkes (Puppen) Kinder-Oper, Regie: P. Wafner
Mered (Revolte) Chordeklamation in Hebräisch, Regie: Abba Kovner
"Das verschwundene Schneiderlein" von Sholem Aleiychem
Stück in vier Bildern, Regie: E. Pilnik
Viele Kinder und Jugendliche konnten nicht zur Schule oder in
den Jugendclub kommen: "Für die älteren existiert sogar ein Gymnasium. Doch es
steht halb leer. Nicht etwa, weil es weniger Kinder in diesem Alter gibt,
sondern weil sie bereits arbeiten. Sie sind in ihren eigenen Augen und in den
Augen anderer keine Kinder mehr. Ich vergesse ja selber auch oft genug, dass ich
erst vor kurzem vierzehn geworden bin. Lieber nicht daran denken, sonst sehnt
man sich so danach, Gedichte zu lesen ... Man möchte heulen! Jetzt würden mir
sogar die Lehrsätze, sogar die Physik Spaß machen. Aber ... Mutti und Mira
arbeiten, jemand muss bei den Kindern bleiben, sich vor den Läden anstellen."
(Rolnikaite, S. 70)
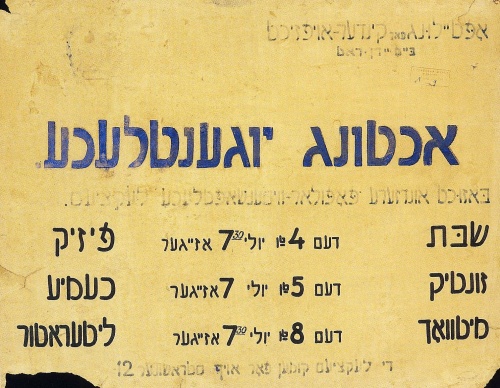
Aufruf an die Jugend
Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters, 2.VZM 1221
Übersetzung:
Kinderabteilung des Judenrats
Achtung Jugendliche
Kommt zu unseren populärwissenschaftlichen Vorträgen
Shabbat - 4. Juli um 7.30 Uhr - Physik
Sonntag - 5. Juli um 7.00 Uhr - Chemie
Mittwoch - 8. Juli um 7.30 Uhr - Literatur
Die Stunden werden in der Strashuner 12
abgehalten.
Yitzhak
Rudashevski schrieb am 7.
Oktober 1942 in sein Tagebuch: "Das Leben ist ein bisschen interessanter
geworden. Die Arbeit im Club hat begonnen. Es gibt Gruppen für Literatur und
Naturwissenschaft. Nach Ende der Schule um sieben Uhr dreißig gehe ich sofort in
den Club."
(Rudashevski, S. 65/66)
22. Oktober: "... Unsere Jugend arbeitet und geht nicht unter. Unsere
Geschichtsgruppe arbeitet. Wir hören Vorlesungen über die Französische
Revolution, über ihre Phasen. Die zweite Abteilung der Gruppe, Ghettogeschichte,
ist auch aktiv. Wir untersuchen die Geschichte des Hofes in der Shavler 4.
Interviews müssen unter den Mitgliedern verteilt werden, die diese den Bewohner
des Hofes stellen." (Rudashewski, S. 73)
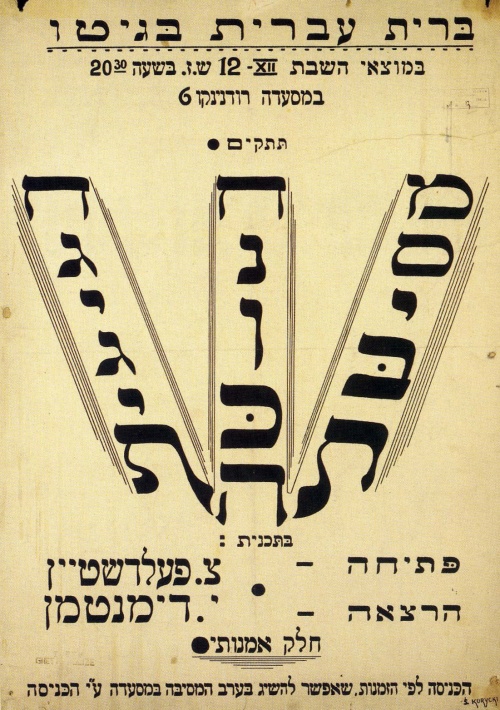
Chanukka-Abend
Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters, 7.VZM 1220
Übersetzung:
die Brith Ivrit Gruppe im Ghetto
Shabbatabend 12.12. um 20.30
findet statt im Restaurant Rudninku 6
Chanukka-Festabend
Programm:
Eröffnung - Tz. Feldshteyn
Lesung - I. Dimentman
künstlerisches Programm
Einlass mit Einladungen, die am Abend des Festabends am Restauranteingang zu
erhalten sind.
Wissenschaftliche Kreise
WissenschaftlerInnen und Literaten schlossen sich
in Zirkeln zusammen, vereinbarten gegenseitige Unterstützung und versuchten,
ihre Arbeiten und Studien in der Ghettosituation fort zu führen und den Menschen
im Ghetto zugänglich zu machen.
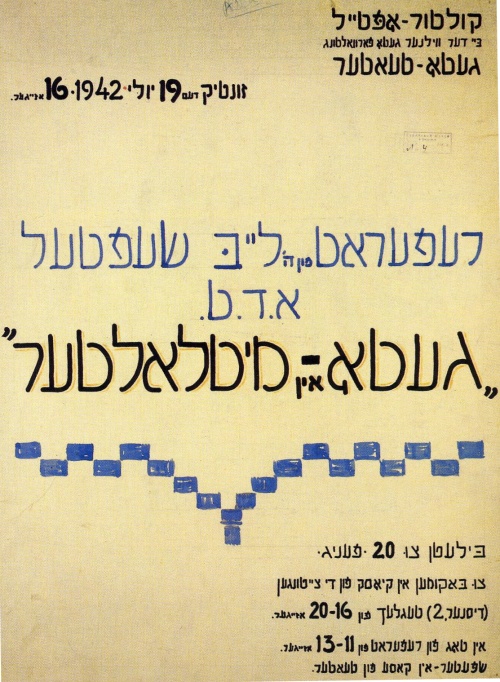
das Ghetto im MIttelalter
Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters, 3.VZM 1218
Übersetzung:
Kultur-Abteilung
der Wilnaer Ghettoverwaltung
Ghettotheater
Sonntag, 19. Juli 1942 um 16.00 Uhr
Vortrag von Leib Sheftel zu dem Thema
"Ghetto im Mittelalter"
Eintrittskarten kosten 20 Pfennig.
Sie sind am Zeitungskiosk auf der Disner 2 zu bekommen, täglich von 16.00 bis
20.00 Uhr,
am Tag des Vortrags von 11.00 bis 13.00 Uhr,
später - an der Theaterkasse
KünstlerInnen und LiteratenInnen unterstützen die
Arbeit in den Schulen und im Club. Die Jugendlichen bereiteten Veranstaltungen
und Aufführungen vor, die vor den ZwangsarbeiterInnen oder im Ghettotheater
gespielt wurden.
Montag, 2. November 1942
"Heute hatten wir ein sehr interessantes Gruppentreffen mit dem Dichter A.
Sutzkewer. Er sprach mit uns über Dichtung, über Kunst im Allgemeinen und über
Unterteilungen in der Dichtung. In unserer Gruppe wurden zwei wichtige und
interessante Entscheidungen gefällt. Wir schaffen neue Sparten in unserer
Literaturgruppe: Jiddische Dichtung, und das wichtigste, eine Abteilung, die
Ghettofolklore sammeln wird. Diese Arbeit interessiert mich sehr. Wir haben
schon über einige Details gesprochen. Im Ghetto entstehen vor unseren Augen eine
Menge Redensarten, Ghettoflüche und Ghettosegen; etwa Begriffe wie ´vashenen` -
ins Ghetto schmuggeln, sogar Lieder, Witze und Geschichten, die schon wie
Legenden klingen. Ich fühle, ich werde mit aller Energie in diesem Zirkel
arbeiten, weil die Ghettofolklore, die so unglaublich aus Blut entstand und die
über die kleinen Gassen verstreut ist, muss gesammelt und für die Zukunft
erhalten bleiben." (Rudashevski, S. 81)
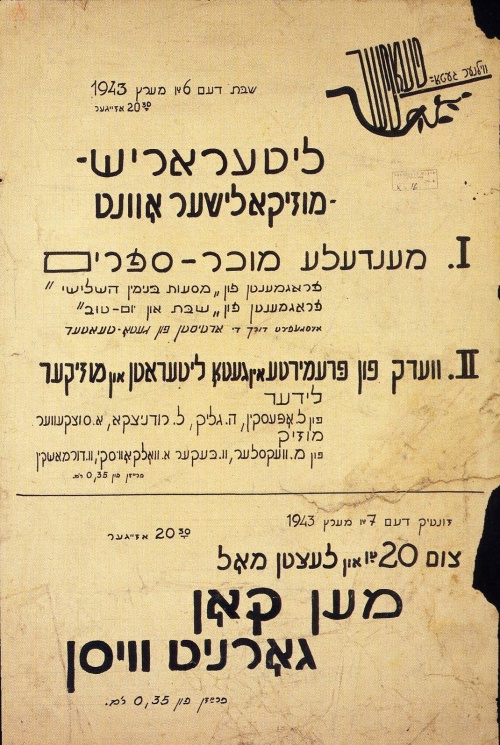
Literatur-Abend
Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum,
Posters, 11.VZM 1216
Übersetzung:
Wilnaer Ghettotheater
Shabbat, 6. März 1943 um 20.30 Uhr
Literarisch-musikalischer Abend
I. Mendele Moykher-Sforim
Auszüge aus "Die Reisen Benjamin des Dritten"
Auszüge aus "Shabbat und Feiertage"
vorgestellt von den Schauspielern des Ghettotheaters
II. Arbeiten der Preisgewinner in Ghettoliteratur und - musik
Lieder von L. Opeskin, H. Glik, L. Rudniska, A. Sutzkever
Musik von M. Weksler, V. Beker, A. Wolkowisky, V. Durmashkin
Eintritt: 35 Pfennig
Sonntag, 7. März 1943 um 20.30 Uhr
zum 20. und letzten Mal
Niemand kann´s wissen
Eintritt: 35 Pfennig
Die Bibliothek im Ghetto

das Gebäude der Bibliothek im Ghetto
Strashungasse 4,
Foto 2002

Mefitze Haskole
Gedenktafel für den Begründer der "Mefitze Haskole" Bibliothek
Matthias Strashun, 1817-1885, Foto 2002 (GS)
Die Idee, die alte und bedeutsame Bibliothek "Mefitze Haskole",
die innerhalb der Ghettomauern stand, zu erhalten war eine Idee des Bundisten
Herman
Kruk. Aus dieser Idee wurde ein
wichtiges kulturelles Zentrum des Ghettos. Der Bestand der Bibliothek waren die
noch nicht von Deutschen geplünderten Bücher der ehemaligen Bibliothek.
Aufgestockt wurde er mit ins Ghetto geschmuggelten Werken, die in der Stadt
arbeitende ZwangsarbeiterInnen mitbrachten.

Chronik des Wilnaer Ghettos
Hinter diesem Fenster schrieb Herman Kruk die Chronik des Wilnaer
Ghettos
Foto 2002
Herman Kruk schrieb in einem Bericht aus Anlass des einjährigen
Jubiläums der Bibliothek: "… Die traurigen Ereignisse am 2./3. September 1941
(vgl. Grosse Provokation, G.S.), die Umsiedlung in das Ghetto und die ersten
Tage des Ghettolebens ließen in keiner Weise ahnen, dass das Buch bei den
gejagten und geplagten Lesern noch ein anderes als ein rein materielles
Interesse würde wecken können.
Für die meisten dient das Buch zum Zeitvertreib, und nur einer Minderheit zur
Bildung, zur Selbstreflexion, Vertiefung und Vervollkommnung – wem wäre jetzt
daran gelegen?
… Im Ghetto Bücher lesen – mit dieser Idee konnte kaum jemand etwas anfangen. So
sah es jedenfalls am 8. September (1941) aus, als die Bibliothek ´beschlagnahmt`
wurde. Als aber die Bibliothek am 15. September für die Ghettoleser eröffnete,
zeigte sich, dass die früheren Annahmen weit von der Wirklichkeit entfernt
gewesen waren: die neuen Ghetto-Bürger drängten sich wie durstige Lämmer nach
den Büchern. …
Der Mensch erträgt Hunger, Not und Schmerz, aber nicht die Einsamkeit. Stärker
noch als unter normalen Bedingungen ist er in Notzeiten auf Bücher angewiesen…."
(YIVO, RG 223-369/370)
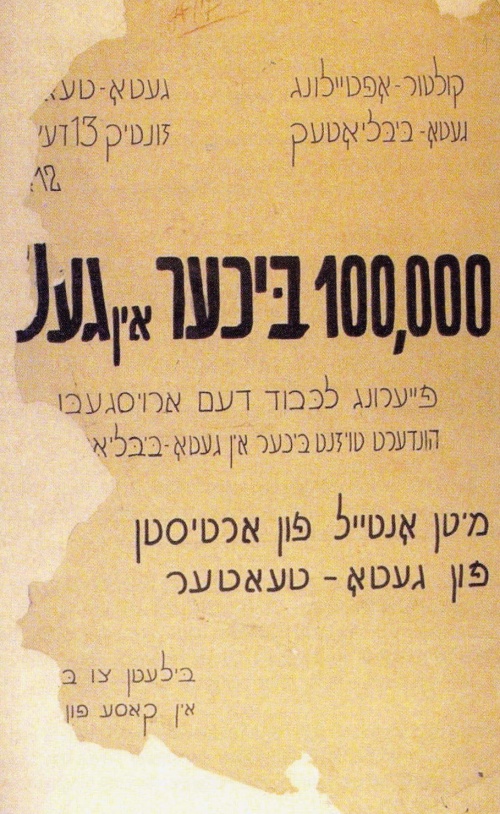
100.000ste BUCHAUSLEIHE
Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters,
8.VZM 1219
Übersetzung:
Kulturabteilung
Ghettobibliothek
Ghettotheater
Sonntag, 13. Dezember um 12.00 Uhr
100.000 Bücher im Ghetto
Feierlichkeit zur 100.000sten Buchausleihe in der
Ghettobibliothek mit Teilnahme der Schauspieler des Ghettotheaters
Eintrittskarten sind an der Theaterkasse erhältlich
Ghettotheater
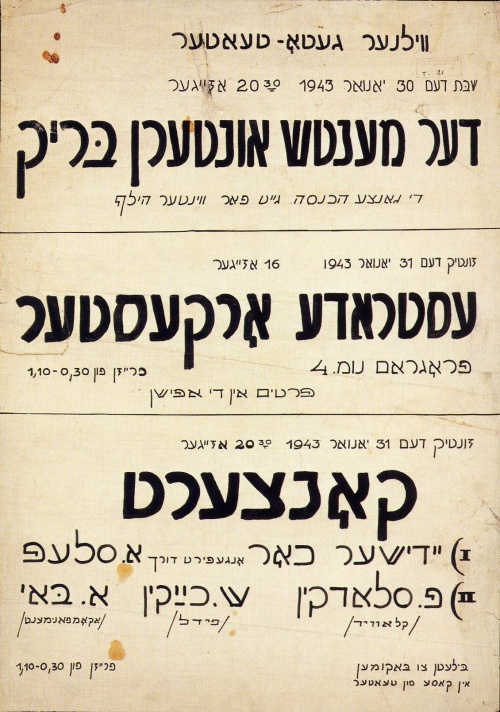
DOKUMENT THEATERPLAKAT
Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters,
10.VZM 104
Übersetzung:
Wilnaer Ghettotheater
Shabbat, 30. Januar 1943, 20.30 Uhr
Der Mensch unter der Brücke
Die Erlöse fließen der Winterhilfe zu
Sonntag, 31. Januar 1943, 16.00 Uhr
Varieté-Orchester
Programm Nr. 4
Einzelheiten auf den Plakaten
Sonntag, 31. Januar 1943, 20.30 Uhr
Konzert
I. Jiddischer Chor unter der Leitung von A. Slep
II. P. Sladkin (Klavier), Sh. Chaikin (Violine), A. Bai (Begleitung)
Eintrittskarten sind an der Theaterkasse erhältlich
Preise von 0,30 bis 1,10
Im Ghettotheater wurden Stücke aus der jüdischen Literatur gegeben und Konzerte,
in denen die Menschen für kurze Zeit dem grausamen Alltag entfliehen konnten.
Die Ankündigung des ersten Konzertes im Ghetto löste heftige Kontroversen aus.
Flugblätter wurden an die Wände der Häuser geklebt: "Auf dem Friedhof spielt man
kein Theater". Doch schon am Tag nach der Veranstaltung verstummte die
öffentliche Kritik: In den Tagebüchern und Memoiren können wir nachlesen, wie
tief das Erlebnis des Konzerts gewesen sein muss. Das gemeinsame Besinnen, das
Gedenken an die Toten hatte einen großen Eindruck hinterlassen und es hatte sich
gezeigt, dass die Kultur der Situation gerecht werden konnte. In der ersten Zeit
des Theaters wurden Stücke der jiddischen Literatur gespielt, später kamen
eigene Ghettoproduktionen hinzu.

Gedenktafel für das Ghettotheater
"An diesem Ort war Dank des heldenhaften Einsatzes
der Künstler im Ghetto das Ghettotheater.
"
Gedenktafel des Jewish Gaon Jewish State Museums an das jüdische
Ghettotheater,
Foto 2002
Bewaffneter Widerstand
Es waren vor allem die Jugendlichen, größtenteils Mitglieder der
Jugendbewegungen, die sich entschlossen, den Deutschen auch physischen und
bewaffneten Widerstand entgegen zu setzen. In vielen Fällen waren die
AktivistInnen auch in den kulturellen Initiativen des Ghettos tätig – ein
Zeichen, wie wenig sich die verschiedenen Formen des Widerstands trennen lassen.
Schon Ende Dezember 1941 wurde die Gründung der F.P.O., der
Vereinigten Partisanenorganisation, beschlossen. Bei einem Treffen von etwa 150
Jugendlichen wurde der erste Aufruf zum Widerstand verlesen:
Aufruf F.P.O.
Übersetzung:
Die Vereinigte Partisanenorganisation
des Wilnaer Ghettos (F.P.O.)
Der erste Aufruf
"Lassen wir uns nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen!
Jüdische Jugend!
Glaubt nicht den Verführern. Von den 80.000 Juden im ´Jerusalem von Litauen`
blieben nur 20.000. Vor unseren Augen haben sie unsere Eltern, Brüder und
Schwestern entrissen.
Wo sind die Hunderte von Menschen, die von den litauischen Häschern zur Arbeit
entführt wurden?
Wo sind die nackten Frauen und Kinder, die in der schrecklichen Nacht entführt
wurden?
Wo sind die Juden vom Jom-Kippur-Tag?
Und wo sind unsere Brüder aus dem zweiten Ghetto?
Von denen, die vor das Ghettotor geführt wurden, kehrte kein einziger zurück.
Alle Wege der Gestapo führen nach Ponar.
Und Ponar ist der Tod!
Ihr Zweifler, lasst alle Illusionen fallen! Eure Kinder, Männer und Frauen sind
nicht mehr am Leben. Ponar ist kein Lager. 15.000 wurden dort durch Erschiessen
getötet.
Hitler beabsichtigt, alle Juden Europas zu vernichten. Es ist das Schicksal der
Juden Litauens, als erste an der Reihe zu sein.
Lassen wir uns nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen!
Es ist wahr, wir sind schwach und hilflos, aber die einzige Antwort an den Feind
lautet:
Widerstand!
Brüder! Lieber als freie Kämpfer fallen, als von der Gnade der Mörder leben.
Widerstand leisten! Widerstand bis zum letzten Atemzug!
1. Januar 1942. Wilna, im Ghetto.
Der Aufruf wurde von Abba Kovner (1918-1987) verfasst, einer der
Gründer der F.P.O.
Der hier veröffentlichte Text
beruht auf einer Übersetzung aus dem Jiddischen, die Arno Lustiger besorgte,
Herausgeber des Schwarzbuchs. Der Mord an den europäischen Juden von
Grossmann/Ehrenburg
Die F.P.O. war eine konspirative, militärische Organisation.
Ziele der Bewegung waren Sabotageaktionen gegen die Deutschen und ihre
Einrichtungen, die Selbstverteidigung des Ghettos und die Errichtung eines
Netzes von Widerstandsgruppen in den Ghettos.
Fast alle politischen Organisationen beteiligten sich:
Verschiedene zionistische Parteien von HaShomer
HaZair bis zu den Revisionisten (vgl. Betar) und die
Kommunisten. Zu Beginn verweigerte der Bund die Zusammenarbeit,
da die Mitglieder nicht mit den Revisionisten zusammen arbeiten wollten. Der
Bund trat im Sommer 1942 der Organisation bei. Am 23. Januar 1942 wurde ein
Führungsstab gewählt mit Yitzhak
Witenberg
(Kommunist) zum Kommandanten, Glasman (Revisionist) als militärischer Leiter und
Abba Kovner
(HaShomer HaZair) als Sekretär. Es wurden kleine Gruppen
eingeteilt, die in strenger Konspiration arbeiteten. Waffenbeschaffung und die
Ausbildung waren die ersten Aufgaben.
Woher bekam die F.P.O. Waffen?
Wirkliche Verbündete gab es vorerst keine. Die erste Granate
soll über eine polnische Untergrundgruppe zur F.P.O. gelangt sein. Doch
ansonsten waren die Waffenlager der Deutschen das wichtigste Reservoir:
Mitglieder der F.P.O. arbeiteten in den Munitionslagern und hier wurden
verplombte Waggons und Kisten geöffnet und die Waffen in Einzelteilen in das
Ghetto geschmuggelt (nach Zeugnis Nisan Reskin,
YIVO RG 223-649; vgl. Sutzkewer, Kaczerginski). Die Waffen gingen die
gleichen Wege wie die in das Ghetto geschmuggelte Nahrung. Der Transport durch
die Stadt und vor allem durch das Ghettotor war gefährlich. Es wurde ein
Warnsystem errichtet, das die Schmuggelnden informierte, ob vertrauenswürdige
Ghettopolizisten am Tor die Kontrolle durchführten. Wenn nicht, oder gar, wenn
Murer
sich am Tor aufhielt, mussten die Waffen irgendwo gebunkert werden, um
einen günstigen Moment abzuwarten, sie ins Ghetto zu schaffen. Die Waffen wurden
in Malinen gebracht.
Es gab sehr wenig bis keine Erfahrung im Umgang mit den Waffen.
Ausbildungsgruppen wurden gebildet und in besonders tiefen Malinen Schießübungen
abgehalten. Hier wurde auch Sprengstoff gemischt und die Pläne für die
Sabotageaktionen ausgearbeitet.

EINGANG SHTRASHUN 4
Der Eingang zum
Wie wurde die Information aufrechterhalten?
Eine erste wichtige Anschaffung für die F.P.O war die eines
Radios. Die Deutschen hatten gleich nach dem Einmarsch alle Radiogeräte von
Juden konfisziert. Mit dem illegalen Radio wurden die Kriegsgeschehnisse
abgehört. In den Aufzeichnungen über das Ghetto sind immer wieder zwei
Ereignisse, die auch über das Radio in das Ghetto gelangten, erwähnt, die die
Stimmung stark beeinflussten: Einmal waren das die Meldungen, die darüber
informierten, dass der geplante "Blitzkrieg" der Deutschen nicht gelang. Die
Rückschläge, die die deutsche Wehrmacht in Russland ab November 1942 einsteckte
und vor allem die Niederlage bei Stalingrad, ließen Hoffnung aufkommen:
Vielleicht konnte doch noch Hilfe von außen kommen und eine Befreiung war
möglich? Ein anderes Ereignis, das, wenn auch nur für kurze Zeit, Hoffnung und
Mut in den Widerstandsgruppen erzeugte, war der Aufstand im Warschauer Ghetto im
April 1943. Zeigte er doch, dass Widerstand möglich war!
Einige Mitglieder der F.P.O. lebten getarnt außerhalb des
Ghettos. Es waren vorrangig Frauen, die Funktionen als Kurierinnen und
Verbindungsleute übernahmen, weil sie sich unverdächtiger bewegen konnten.
Frauen wie Sonje
Madeisker übernahmen die
Beschaffung von illegalen Wohnungen in der Stadt, hielten die Kontakte zu den
Kurierinnen anderer Ghettos und zu den Partisanen im Wald. Der Aufruf aus dem
Wilnaer Ghetto gelangte über Kurierinnen in andere Ghettos - nach Kowno,
Bialystok, Warschau etc. und auch dort entstanden Widerstandsgruppen.
Kurierinnen schleusten sich auch in kleinere Ghettos, um vor bevorstehenden
Aktionen der Deutschen zu warnen.
Wie sahen die Pläne der F.P.O. aus?
In der F.P.O. gab es zwei Ansätze oder Ideen, Widerstand zu
leisten, die heftig diskutiert wurden: Eine Meinung war, es sei das effektivste,
aus dem Ghetto in die Wälder zu gehen und dort gemeinsam mit den Partisanen
gegen die Deutschen zu kämpfen, um ihnen möglichst viel Schaden zuzufügen. Die
andere Meinung sah als ein Hauptziel des Widerstands die Verteidigung des
Ghettos. Es setzte sich die Linie durch, im Ghetto zu bleiben und die Menschen,
die nicht mehr in der Lage waren, zu den Waffen zu greifen oder es nicht
wollten, nicht allein zu lassen. Wenn das Ghetto liquidiert werden sollte,
sollte es verteidigt und vorher möglichst viele Menschen für den Aufstand
gewonnen werden. Auf dieses Ziel hin war die Arbeit der F.P.O. im Ghetto
ausgerichtet.
Außerhalb des Ghettos wurden Sabotageaktionen durchgeführt – im
Juli 1942 sprengte die F.P.O. einen deutschen Waffentransport aus den Schienen –
es war die erste Sabotage dieser Art, seit die Deutschen das Land überfallen
hatten (vgl. Levin, S. 111). Auch in den Zwangsarbeitslagern kam es zu
Sabotageakten. In einer illegalen Druckerei wurden Flugblätter gedruckt, die, in
der Stadt verteilt, zum Widerstand gegen die Deutschen aufriefen. Die F.P.O.
wurde größer.
Juli 1943
Im Juli 1943 waren bei Razzien in der Stadt einige Männer
festgenommen worden. Unter der Folter der Gestapo fiel der Name
Witenberg.
Kittel, der mittlerweile in Wilna
stationiert war, verlangte seine Auslieferung, andernfalls drohte er mit der
Vernichtung des Ghettos. Witenberg wurde im Ghetto gefangen genommen, doch
gelang es F.P.O. – Kadern ihn zu befreien. Witenberg hielt sich versteckt und
die schwierige Situation wurde debattiert. War dies der Zeitpunkt, sich den
Deutschen mit allen Möglichkeiten entgegen zu stellen? Konnte es zugelassen
werden, dass der Kommandant in die Hände der Deutschen fiel? Dennoch kam man
gemeinsam zu dem Schluss, dass die Liquidierung des Ghettos in jedem Fall
verhindert werden müsse. Druck kam von Seiten der Ghettoleitung, die für die
Auslieferung plädierte, ebensolche Stimmen wurden im Ghetto laut. Witenberg
begab sich zur Gestapo. Er wurde am nächsten Tag tot und verstümmelt
aufgefunden. Es gab keine weiteren Verhaftungen.
Der Verlust des Kommandanten belastete die Bewegung. Zudem
nahmen die Spannungen mit der Ghettoleitung zu. Die Deutschen hatte nun
zumindest eine Ahnung, dass es Widerstand im Ghetto gab, wenn ihnen auch keine
Details bekannt waren.
Liquidierung des Ghettos
Im September 1943 wurde das Ghetto liquidiert. Gruppen der
F.P.O. hatten drei bewaffnete Barrikaden errichtet. An der ersten verteidigte
die Gruppe von Yechiel
Sheynboym
die Straße und schlug die Deutschen zurück. Diese antworteten mit der Sprengung
der Gebäude. Die Deutschen rückten nicht weiter vor in das Ghetto und zogen sich
zurück. Die restlichen WiderstandskämpferInnen gelangten zu der Einsicht, dass
es nicht mehr zu einem breiter getragenen Aufstand kommen werde. Der Rückzug der
Deutschen wurde zur Flucht genutzt. Sie verließen das Ghetto durch die
Kanalisation und schlossen sich den Partisanen an.
Es kam nicht zu einem breit getragenen Aufstand in Wilna. Viele
hofften noch auf irgendeine Art und Weise zu überleben und die Teilnahme am
Aufstand bedeutete den sicheren Tod. Wir wissen heute, dass jede Entscheidung
nur mit einer sehr geringen Überlebenschance verbunden war.
DIE HYMNE DER WIDERSTANDSBEWEGUNG
Das Lied ist von Hirsh Glik. Er war Mitglied der F.P.O. und
schrieb das Lied nach dem Ausbruch des Warschauer Aufstandes am 19. April 1943in
einem Zwangsarbeiterlager bei Wilna. ZOG NISHT KEYN MOL wurde in ganz Osteuropa
das Lied der jüdischen Partisanen. Hirsh Glik wurde bei der Liquidation des
Wilnaer Ghettos nach Estland deportiert und ermordet.
(Übersetzung nach Daniel Kempin: mir leben eybik!
Lider fun getos un lagern)
ZOG NISHT KEYN MOL
[Anhören - RealAudio]
zog nisht keyn mol,
az du geyst dem letstn weg.
khotsh himlen blayene
farshteln bloye teg.
kumen wet nokh undzer
oysgebenkte sho,
s´vet a poyk ton undser trot,
mir zenen do!
fun grinem palmenland
biz waytn land fun shney
mir kumen on mit undzer payn,
mit undzer wey.
un wu gefaln iz a shprits
fun undzer blut,
shprotsn wet dort
undzer gvure, undzer mut!
s´wet di morgnzun
bagildn undz dem haynt
un der nekhtn
wet farshvindn mit´m faynd.
nor oyb farzamen
wet di zun un der kayor,
wi a parol zol zayn dos lid
fun dor tsu dor.
dos lid geshribn iz
mit blut un nisht mit blay.
s´ iz nisht keyn lidl
fun a foygl oyf der fray.
dos hot a folk
tsvishn falndike went
dos lid gezungen
mit naganes in di hent!
SAGE NIEMALS …
Sage niemals,
dass du den letzten Weg gehst,
auch wenn bleierne Himmel
die blauen Tage verfinstern.
Kommen wird noch unsere Stunde,
unser Schritt wird mächtig sein, wir sind da!
Vom grünen Palmenland bis zum
fernen, Schnee bedeckten Land
kommen wir her mit unserer Pein
und unserem Schmerz.
Wo immer ein Tropfen unseres
Blutes hinfiel,
werden dort unsere Stärke, unser
Mut hervorwachsen!
Vergolden wird uns
die Morgensonne das Heute,
und das Gestern wird mit dem
Feind verschwinden.
Aber wenn die Sonne und
die Morgendämmerung uns verpassen,
soll das Lied wie eine Hymne sein,
von Geschlecht zu Geschlecht.
Geschrieben ist das Lied
mit Blut und nicht mit Blei.
Es ist kein Lied
eines Vogels in der Freiheit.
Dieses Lied hat ein Volk
Zwischen einstürzenden Mauern
gesungen,
mit Pistolen in den Händen.
Direkt
Hören
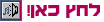
oder Download
[Sog nischt
kejnmol]
[Übersicht:
Spurensuche jüdischer Geschichte
– das Ghetto in Wilna]
>> Nächster Teil: Nachkrieg

hagalil.com 21-02-2003 |